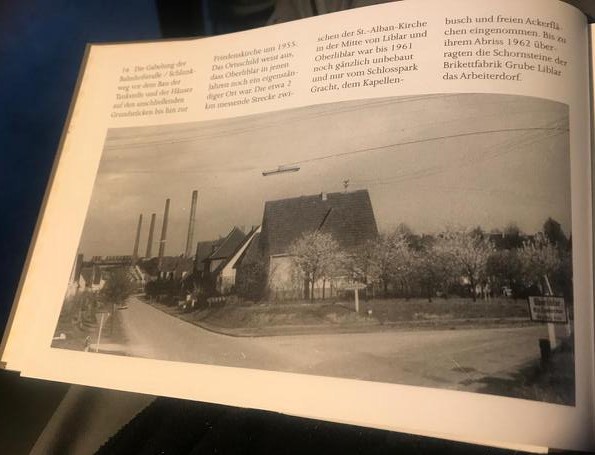- Beiträge: 3
Heimatkunde,
- Dr. Dieter Esser
-

- Offline
Weniger
Mehr
5 Jahre 1 Woche her - 4 Jahre 11 Monate her #1
von Dr. Dieter Esser
Heimatkunde, wurde erstellt von Dr. Dieter Esser
Liblar-Süd oder das ewige Neubaugebiet.
Noch heute, Jahrzehnte nach dem Baubeginn im Süden von Liblar, sprechen ältere Bürger vom „Neubaugebiet“. Dieser Baubeginn war am Ende der Sechzigerjahre und in den siebziger Jahren konnte man bestaunen, was dort, wo früher Felder waren, entstanden war.
1970 gab es den ersten „Wohnpark - Report“. Maßgeblich beteiligt am Zustandekommen und an der erfolgreichen Fortsetzung dieser kostenlosen Broschüre waren Walter Keßler, Gisela Koschmider, Günther Lapp, Barbara Henseler, Werner Birkwald und später Prof. Manfred Görlach.
Als alter Oberliblarer habe ich die Entwicklung natürlich aufmerksam verfolgt. In den Schulen, also auch an meiner Schule, saßen Schülerinnen und Schüler die in Straßen wohnten, die wir vorher nie gehört hatten. Wir wussten zwar, wer Bertolt Brecht, Leibnitz, Kant, ja sogar Henry Dunant und einige der anderen waren, aber dass Liblar, unser Liblar, jetzt Straßennamen mit diesen Persönlichkeiten bekommen hatte, war zunächst fremd für uns.
Und es klang schon komisch, wenn jemand von der „Hennri Dünang-Straße“ sprach. Vielleicht hätte der Initiator der neuzeitlichen Olympischen Spiele, also „Ohri Dünoh“, ihm das verziehen.
Eines Tages fragte mich Walter Keßler, ob ich Lust hätte, etwas für den „Wohnpark - Report“ zu schreiben. Es sollte etwas Heiteres sein, das die Problematik des Zusammenwachsens irgendwie erfassen sollte.
Und so entstanden die folgenden Geschichten in den Jahren ab 1979.
Natürlich habe ich mir lange überlegt, ob meine, durchaus ein wenig bösartigen Geschichten hier ihren Platz haben. Ich meine ja.
Also lauschen wir zunächst einem fiktiven Vortrag aus dem Jahr 3977.
Fast wahre Geschichten (1)
Ein fast wahrer Vortrag aus dem Jahr 3977
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich habe heute die Ehre, als Vertreter der Universität Frechen - Marsdorf zu Ihnen zu sprechen. Mein Thema sind die jüngsten Ausgrabungen in der Köln - Bonner Bucht, die, wie Sie alle wissen, in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts einmal von Menschen bewohnt gewesen sein muss und aus bisher ungeklärten Gründen bis vor einem Jahr unter einer dicken Erdschicht lag.
Es ist uns Archäologen gelungen, große Teile einer Siedlung freizulegen, die einmal den Namen Erftstadt oder ähnlich getragen haben muss. Es wurde eine Tafel gefunden, vermutlich ein Ortsschild, auf dem die Buchstaben L I B L… zu lesen sind. Über die Bedeutung dieser Buchstaben sind wir uns noch nicht im Klaren. Vermutlich ist L I B L … eine verstümmelte, fehlerhafte Form des Namens
L I E B L O S. Die Gelehrten sind sich einig, dass LIEBLOS mit hoher Wahrscheinlichkeit die Stadtplanung und Bauweise bezeichnete. Nehmen wir also an, und weitere Ausgrabungen werden das sicher noch bestätigen, dass der Ortsteil „Erftstadt – Lieblos – hieß.
Unsere Grabungen begannen im höher gelegenen Teil des Ortes. Zunächst stießen wir auf ein Gebäude, auf dem das Wort „Bahnhof“ zu lesen war. Nun gibt es zwar seit gut 1500 Jahren keine Bahnhöfe mehr, aber aus alten Handschriften ist uns bekannt, dass es sich bei einem „Bahnhof“ um eine Haltestelle für Eisenwagen, auch Eisenbahn genannt, gehandelt haben muss.
Doch bei dem von uns ausgegrabenen Bahnhof steht die Forschung vor einem unlösbaren Rätsel: sollte eine sonst recht ordentliche und solide gebaute Stadt wie Erftstadt-Lieblos ein solch altes, unbrauchbares Gebäude wirklich noch 1977 als Bahnhof benutzt haben?
Wir glauben, dass so viel Geschmacklosigkeit nicht einmal in einem solchen Ort herrschte. Daher nehmen wir an, dass das Gebäude als Museum benutzt wurde, zumal die Innenwände deutliche Spuren künstlerischer Tätigkeit zeigen, moderne, etwas gewagte Kunst, wenn Sie wissen, was ich meine, meine Damen und Herren.
Im oberen Teil des Ortes ergaben sich zum Erstaunen aller Archäologen eigenartige Funde. Wir gruben Straßenschilder aus mit der Bezeichnung Heidebr.., Bahnhofs.... und Schlunk... Leider konnten wir auch hier nur unvollständige Namen finden.
Aber das ist nicht so wichtig wie die Entdeckung von Professor Müller aus Oberkassel: Er fand mit seinem Team eine große Anzahl von menschlichen Körpern. Auffällig war daran, dass sie stets trockene Haut hatte. Sie müssen also auf irgendeine Weise verdurstet sein. Vermutlich funktionierte die Wasserversorgung dort oben nicht reibungslos.
Etwas kräftigere Körper fanden wir in der Nähe eines Waldes, vielleicht handelt es sich um einen Park. Die Menschen lebten hier in riesigen, oft flachen Häusern, oft nur zu zweit und offensichtlich auch mit Hunden. Für uns Menschen des vierten Jahrtausends ist das unvorstellbar, aber damals war das wohl so üblich.
Die Menschen in diesen Häusern müssen ungeheure Angst vor Angriffen ihrer Nachbarn gehabt haben, denn fast alle Häuser sind mit Zäunen umgeben. Es kann natürlich auch sein, dass die betreffenden Menschen von hoher Bedeutung gewesen sind. Das wage ich nicht zu entscheiden.
Fast überall in den tiefer gelegenen Ortsteilen förderten unsere Ausgrabungen Gummischläuche zutage, die auf Grünflächen gelegen haben müssen. Ich möchte nicht behaupten, dass hier vielleicht Wasser vergeudet wurde, um die höher gelegenen Ortsteile systematisch zu vernichten. Vielleicht gelingt es den Forschern, irgendwann einmal eine Erklärung dafür zu finden.
Mittler – Weile haben wir auch den südlichen Teil der Stadt ausgegraben. Dabei stießen wir auf fast unüberwindliche Hindernisse: Die einzelnen Häuser liegen so eng beieinander, dass ein ruhiges Ausgraben nicht möglich ist.
Am interessantesten fanden meine Kollegen und ich die frappierende Ähnlichkeit mit der 2035 verschütteten Stadt New York. Vergeblich jedoch suchten wir ein mit der Freiheitsstatue vergleichbares Bauwerk, obwohl anzunehmen ist, dass sich die Erbauer des betreffenden Stadtteils ein Denkmal setzen wollten.
Wir nehmen deshalb außerdem an, dass es sich bei den sehr hohen Gebäuden nicht nur um pure Bosheit handelte, sondern dass hier der selbstlose Einsatz einiger weniger den Turmbau zu Babel wiederholen wollte. In Babel gab es bekanntlich eine Sprachverwirrung. Sollte auch in Erftstadt – Lieblos einer den anderen nicht verstanden haben???
Ich lasse die Frage offen, verweise vielmehr auf das soeben erschienene Buch „Erftstadt - Lieblos im Wandel der Jahrtausende“ und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
P.S. Die Ausgrabungen gehen weiter.
Fast wahre Geschichten. (2)
Betrachtungen aus der Natur: Der Erftstädter (Homo Alogicus).
Es ist schon seltsam, dass die Zoologie sich bis heute um die Beschreibung der Spezies Alogicus, oder auch „Erftstädter“ herumgedrückt hat. Ob dies Bosheit, Desinteresse oder einfach Unkenntnis, will ich hier offen lassen. Fest steht, dass hier schändliches Versagen der Wissenschaft eine Lücke gelassen hat, die geschlossen werden muss.
Welche Bedeutung der Erftstädter im Tierreich hat, lässt sich schwer abschätzen, man darf jedoch annehmen, dass sie an Intelligenz weit über dem Opossum oder dem Erdmännchen liegt. Dies lässt sich schon aus den Behausungsanlagen erkennen. Über die Lebensweise, Gewohnheiten und Knochenbau liegen so wenige Untersuchungen vor, dass intensive Nachforschungen angestellt werden mussten. Ich trage Ihnen hier einige der Ergebnisse vor.
Der Erftstädter gehört zur Familie der Säugetiere. Er ist leicht zu erkennen am meistens aufrechten Gang und an seiner von der Zeit und dem ständigen Kampf zerfurchten Stirn. Er bewohnt die an der Erft gelegenen Auen, zum Teil auch höher gelegene, weite Teile eines alten Braunkohlegebiets.
Wegen seines dicken Fells und seiner Schwerfälligkeit lässt sich eine Verwandtschaft mit dem Ville- Bären nicht leugnen. Manche Exemplare haben sogar eine gewisse Affinität zum Grautier. Ich will aber die Grautiere nicht beleidigen.
Die ersten Exemplare des Homo-Erftstadt-Alogicus müssen schon sehr früh die Felder links und rechts der heutigen Carl-Schurz-Straße bewohnt haben, wie die deutlichen Spuren der Verwüstung zeigen.
Es wird vermutet, dass die Römer sie aus Sicherheitsgründen auf ihrem Weg von Köln nach Trier dort zurückgelassen haben, da sie einer Kultivierung des Rheinlandes im Wege gestanden hätten. Doch die bei aller Schwerfälligkeit erstaunliche Wendigkeit und Schnelligkeit im Höhlenbau brachte sehr bald stattliche Erzeugnisse zu Tage
So bauten sie im Gebiet des heutigen Lechenich, Konradsheim, Blessem, Gymnich, Friesheim und Liblar eigenartige Festungen: die für Säugetiere recht seltenen schlossartigen Gebäude. Sie umgaben sie oft mit Wassergräben, wahrscheinlich zum Schutz oder aber auch nur, um sich von den unterlegeneren Exemplaren des Spezies Alogica abzuheben und ständig die Möglichkeit zu haben, die von Fehden geschlagenen Wunden zu kühlen.
Trotz aller Bemühungen scheint es den Erftstädter nicht gelungen zu sein, ihre schlossartigen Gebäude in ihrer Gewalt zu halten: in Liblar überließ man es kampflos einer anderen Spezies, dem Hormon Economicus oder auch Mana-germanicuss, dessen einziges Ziel es zu sein scheint, dem Ur – Liblarer jeden Zutritt zu verwehren.
In Gymnich gar wurde das schlossartige Gebäude von einer weit aggressiveren Spezies besetzt, dem sogenannten Homo Politicus oder auch Sozio-Democraticus. Es sollen über der Befestigung schon Geier gesehen worden sein, Pleitegeier.
Die praktische Veranlagung des auf den Ville-Auen weidenden Erftstädters zeigte sich darin, dass er aus dunkler Erde kleine, steinartige Produkte presste, mit denen er Feuerstellen über längere Zeit zum Brennen bringen konnte. Vermutlich wegen dieser Fähigkeit gab die Naturkunde ihm auch den schmeichelhaften Namen Ober – Liblarer.
Äußerlich unterscheidet er sich kaum vom Lechenicher oder Unterliblarer, dennoch dürfen einige Fortschritte des Ersteren nicht unerwähnt bleiben. So gelang es dem Homo Alogicus Oberliblariensis, die Eisenbahn von Köln nach Euskirchen nicht durch Lechenich oder Liblar, sondern durch Oberliblar fahren zu lassen.
Noch heute zwingen einige Exemplare kurz nach Sonnenaufgang die Eisenbahn dort zum Anhalten. Die Bahn wird auch von Nichtoberliblarern benutzt, was man als Zeichen für das friedfertige Wesen des Oberliblarers deuten darf …
Nach jahrelanger Isolation ist es endlich gelungen, eine neue Spezies in unmittelbarer Nähe des Homo Liblariensis anzusiedeln. Sie lebt meist isoliert und tritt nie in Rudeln auf. Um einen zu engen Kontakt mit den Uransässigen zu vermeiden, baute man einen „Rüger – Park“, in Anlehnung an ein ähnlich klingendes Reservat in Südafrika auch „Rüger Nationalpark“ genannt.
Tatsächlich gelang es den Liblarern, zunächst jeden Kontakt mit den Neuen unmöglich zu machen und die Neuen ihrerseits trugen dazu bei, nicht mit den Liblarern in Berührung zu kommen. Dieser Zustand wurde recht lange aufrechterhalten, einer wusste von anderen nur, dass er existiert.
Wie Säugetiere nun einmal sind, gab es auch die ersten Konflikte. Um einer kämpferischen Lösung aus dem Weg zu gehen, wurde schnell ein Vermittler gerufen, der heute noch unter dem Namen „Mittler – Immob“ bekannt ist. Dennoch: Es gärt, und die Naturkunde steht vor einem Rätsel: sollte es nicht möglich sein, eine friedliche Lösung der Ortsteile zu erreichen?
Ein weit schwierigeres, in der Geschichte der Entwicklung begründetes Phänomen ist die Ur – Feindschaft zwischen den Exemplaren der Spezies Lechenichiensis und der Spezies Liblariensis.
Vielleicht gelingt es der Evolution, zum ersten Mal in der Geschichte der Erde zwei so verschiedene Spezies unter friedlichen Bedingungen zusammenleben zu lassen. Aber zur Zeit sind wir davon noch weit entfernt.
Der Homo Lechenichiensis feiert bald den 700. Jahrestag des aufrechten Gangs, während der Liblariensis ein stolzes Exemplar in Homo Caroli Schurzi vorweisen kann. Lechenich ist schon im Besitz einer Frei-Suhle während der Liblarer sich dank seines zähen Körperbaus noch in den Seen badet, aber schon erste Schritte zur Errichtung einer Hallen-Suhle unternommen hat.
Trotz allem kann man den Erftstädter oder Homo Alogicus als eine gesonderte, wenn auch sonderbares Spezies begreifen.
Es ist gelungen, Einblick in die Verständigungstechniken der Erftstädter zu nehmen: Wissenschaftler von der Universität Frechen - Marsdorf haben wieder einmal Bahnbrechendes geleistet, indem sie Sprech – und Gestikulationsweisen des Erftstädters registriert und untersucht haben. Hier sind einige der wichtigsten Ergebnisse:
Wir müssen deutliche Unterschiede machen zwischen dem Homo Kierdorfiensis und dem Lechenichiensis, dann wieder zwischen dem lippla Liblariensis und dem Bliesheimus.
Am Rand, weil völlig systemfrei, steht der Erpicus, der sich eine Mischung aus Keltisch und Kisuaheli mit Elementen aus dem Niederrheinischen bewahrt hat und es dem Verhaltensforscher außerordentlich schwer macht, mit seinen Tonaufnahmen etwas anzufangen.
Der Erpicus zeichnet sich durch die mehrsilbige Aussprache an sich einsilbiger Wörter aus: Seine Heimat Erp würde er nie anders als „Äräp“ aussprechen, mit leichter Betonung des mittleren „r“. Besonders hübsch muss man sich die Aussprache der Verladestation für Zuckerrüben vorstellen: dort heißt die „Erper Rübenrampe“ oder „ÄräpeRööverramp“. Vielleicht ist die Sprache der Grund dafür, dass sich zum nächst gelegenen Dorf keine direkte Verbindung in Form einer Straße finden lässt: nach Ahrem (in Erpisch: „die doh hinge“) kommt man nur auf Umwegen.
Nun zu den anderen Lautarianten.
Betrachten wir den Kierdorfiensis. Er zeichnet sich durch eine Laune der Natur aus: er hat zwei Backenzähne mehr als der Erpicus, spricht daher völlig anders als der Bliesheimus. Während der Bliesheimus, Homo Rohmedräjer) und der Lechenichensis (Homo Windbüggelensis)) das Fest des Schützenvereins „Schötzefess“ aussprechen, bringt es der Keirdorfiensis auf ein stolzes „Schötzefäls“ mit deutlicher Hervorhebung des an sich nicht vorhandenen „l“ wie im Wort für „essen“: „ählze“.
Der Blessemicus (Homo Agriculturiensis) ist charakterisiert durch die fantastische, nicht voraussagbare Aussprache der Vokale a,e,i,o,u und so heißt „Mist“ auf Blessemisch „Möess“, die „Misteln“ heißen „Möesspelle“.
Ich könnte die Reihe noch beliebig fortsetzen, will aber trotz des interessanten Phänomens hier nur auf einen Vortrag von Professor Hubert Benderbacher hinweisen, der über die Bedeutung einiger Worte des Erftstädtischen geschrieben hat.
Sein letztes Buch heißt: „Was ist häufiger: af un ahn, manneschmool, lutte oder döckes?“
Man kann, soweit ich sehe, feststellen, dass „lutte“ etwa doppelt so oft es wie „döckes“, während „af un ahn“ fast ebenso häufig ist wie „manneschmool“.
Um den Erftstädter zu verstehen, müssen noch viele Jahre intensiver Forschung betrieben werden. Doch diese Zeilen mögen dazu dienen, ein großes Vorurteil auszuräumen. Der Erftstädter ist rau, aber herzlich, im Ganzen gesehen liebenswert und erhaltenswert, ein interessantes Phänomen und gleichzeitig eine Bereicherung für die Naturkunde.
Fast wahre Geschichten (3).
Es brennt.
Eingeweihte wissen, welche Orte im Folgenden gemeint sind. Ja, richtig: es ist Ober … – aber so einfach wollen wir es nicht machen. Jeder sollte sich selbst die Mühe machen herauszufinden, wo sich die beiden Orte befinden. Aber Vorsicht es könnte ja auch ihr Ort sein …
Nun wäre ja eine Feindschaft an sich noch nichts Besonderes, wissen wir doch alle, wie schwach wir Menschen sind. Doch Oberdorf und Unterdorf sind in eigentümlicher Weise durch ihre Feindseligkeiten verbunden.
Es ist eine Hassliebe, die erst aufgehört hat, als man einen neuen, gemeinsamen Gegner fand, das Neubaugebiet. Wir Oberdorfer haben als Braunkohledorf angefangen, die Unterdorfer einige Jahrhunderte vor uns. Die Römer, die von Köln über Lechenich und Zülpich nach Trier und weiter gezogen waren, haben das Unterdorf überhaupt noch nicht gekannt, weil man sich erst hinter Lechenich die ersten Blasen gelaufen hatte und zu einer Rast gezwungen war. Erst mit den Grafen Metternich, die ins Unterdorf ein Schloss bauten, konnte der Stolz der Unterdorfer sich entfalten.
In der alten Auseinandersetzung mit uns Oberdorfern muss man dem Unterdorfern eins zubilligen: Sie haben Heimrecht, und jede Kampfhandlung ist für sie ein Heimspiel. Wir Oberdorfer stehen zwar unter dem Schutz der Heiligen Barbara und des Heiligen Donatus, doch mengenmäßig sind uns die Unterdorfer überlegen. Das gleichen wir wieder aus: wir haben einen Bahnhof - Sie haben Carl-Schurz, wir einen Fußballverein.
Eine Episode sollte stellvertretend für viele erwähnt werden:
Es war an einem heißen Junitag in den fünfziger Jahren. Ein sehr heißer Tag, die Quecksilbersäule wurde ganz lang und blau, 38 °C, und das Feuer hätte sich auch bei größter Vorsicht nicht vermeiden lassen. Ja, es brannte lichterloh. Ein altes Haus drohte den Flammen zum Opfer zu fallen. Die Sirene ertönte. Im Oberdorf. Nur da? Nein, auch im Unterdorf.
Man wird sich fragen, warum in beiden Gemeinden gewarnt wurde. Ein unglücklicher Umstand hatte es so gewollt, dass der Brandherd sich auf der Grenze zwischen beiden Dorfteilen befand.
Und so eilte man hüben und drüben zu seinem Feuerwehrhaus. Die Feuerwehr des Oberdorfes raste bergab, die des Unterdorfs ein Stück bergauf.
Das Unvermeidliche traf ein. Beide Wehren trafen an der Brandstelle ein. Der Brandmeister aus Oberdorf setzte seinen Kampfhelm auf, rückte sein Koppel zurecht und schritt finsteren Blicks auf die Unterdorfer Wehr zu. Der Brandmeister der Unterdorfer griff zur Vorsicht hinter sich und riss eine Sturmaxt aus der Halterung, die er demonstrativ schulterte, bevor er sich auf den Weg zur Verhandlung mit seinem Rivalen machte.
Nun standen sie sich gegenüber. Kräftige, ehrbare Feuerwehrleute, die ihre Aufgabe stets darin gesehen hatten, Brände zu löschen und Menschen zu schützen. Sie standen da: Aug in Aug, Unterdorf gegen Oberdorf. Wer würde nachgeben?
Der Chef der Unterdorfer Feuerwehr richtete noch einmal seine Uniform, dann dröhnte er seinem Todfeind entgegen: „Haut ab, dat is unser Feuer!“
Nun der Oberdorfer Feuerwehrchef: „Quatsch. Siehst du dann nit, dat die Flamme und der Quallem no owwe trecke? Dat is unser Feuer!“
So ging es eine Weile, Behauptung stand gegen Behauptung, keiner gab nach. Das wäre als Schwäche ausgelegt worden. Nun wurde in der Vergangenheit gewühlt: „Wenn mir damals net jewese wöre, als ür Amtsjebäude gebrannt hät, dann hättet ür jetz ene freie Platz mie in ürem fiesen Ungerdörep!“ sagte der Oberdorfer Feuerwehrchef.
„Und wat es mit ürem Fabrikbrand? Wenn mir nit jewese wöre, hätt ür die janze Winter ohne Klütte doh jesesse, ihr Knallköpp! Macht dat ür heem kott, dat es und bliev oser Füer!“, war die ebenso klare wie kränkende Antwort des Unterdorfers.
Keiner der Feuerwehrleute bemerkte, dass es Nachbarn und einigen Passanten mittlerweile gelungen war, mit Wassereimern dem Brand ein Ende zu setzen.
Dem Kassenwart der Kameradschaftskasse von Unterdorf nur ist es zu verdanken dass man sich einigte, ohne die Sturmäxte zu Hilfe zu nehmen. Er trat mutig zwischen die beiden und machte einen grandiosen Vorschlag, der sonst niemandem in den Sinn gekommen wäre: „Löscht doch zusammen!“
Von so viel Klugheit überwältigt begaben sich beide Feuerwehrchefs zu ihren Leuten und erteilten die notwendigen Kommandos. In Windeseile ergoss sich über das längst nicht mehr brennende Haus ein Wasser, das der Regenmenge von acht Jahrzehnten entsprach. Aber es ging ja ums Prinzip.
Jede der beiden Feuerwehren versuchte, die andere in der Wasserleistung zu überbieten. Man achtete beiderseits mehr auf den andern als auf das Haus, das mittlerweile im Besitz eines Kellerschwimmbades war und spritzte, was die Schläuche hergaben.
Leitungen wurden gelegt, der Wassergraben um das Schloss war dank des Einsatzes der Unterdorfer Wehr um einen Kilometer verlagert worden. Karpfen schnappten noch eine Weile nach Luft, gaben aber bald auf.
Die Oberdorfer hatte mithilfe eines ausgeklügelten Rohrsystems einen Waldsee in eine Moorlandschaft verwandelt. Der ganze Segen ergoss sich über das alte Haus. Die Fundamente gaben ihr Bestes, konnten aber den selbstlosen Feuerwehrleuten nicht mehr lange Widerstand leisten.
Es störte auch niemanden, als der Giebel des alten Hauses, der noch einige Minuten aus dem neu entstandenen Teich herausgeschaut hatte, endlich untertauchte. Das Feuer war jedenfalls aus, und zwar mithilfe beider Feuerwehren.
Nun gut, man hatte mit den Wassergüssen die Landschaft ein wenig verändert, und es dauerte Jahre bis jener Ort auf der Grenze zwischen Oberdorf und Unterdorf wieder mit etwas anderem bepflanzt werden konnte als mit Reis.
Zum Dank für die gelungene Aktion stiftete die Amtsverwaltung ein Holzkreuz, das heute noch am Tatort zu sehen ist. Es heißt das „Spürkerkreuz“.
Und so gingen die Jahre dahin, aus den verfeindeten Brüdern sind jetzt Gegner geworden, die sich gegenseitig wieder aufhelfen, um wieder einen Gegner zu haben. Und… man hatte ja die Neuen, aus dem komoschen Neubaugebiet…
Noch heute, Jahrzehnte nach dem Baubeginn im Süden von Liblar, sprechen ältere Bürger vom „Neubaugebiet“. Dieser Baubeginn war am Ende der Sechzigerjahre und in den siebziger Jahren konnte man bestaunen, was dort, wo früher Felder waren, entstanden war.
1970 gab es den ersten „Wohnpark - Report“. Maßgeblich beteiligt am Zustandekommen und an der erfolgreichen Fortsetzung dieser kostenlosen Broschüre waren Walter Keßler, Gisela Koschmider, Günther Lapp, Barbara Henseler, Werner Birkwald und später Prof. Manfred Görlach.
Als alter Oberliblarer habe ich die Entwicklung natürlich aufmerksam verfolgt. In den Schulen, also auch an meiner Schule, saßen Schülerinnen und Schüler die in Straßen wohnten, die wir vorher nie gehört hatten. Wir wussten zwar, wer Bertolt Brecht, Leibnitz, Kant, ja sogar Henry Dunant und einige der anderen waren, aber dass Liblar, unser Liblar, jetzt Straßennamen mit diesen Persönlichkeiten bekommen hatte, war zunächst fremd für uns.
Und es klang schon komisch, wenn jemand von der „Hennri Dünang-Straße“ sprach. Vielleicht hätte der Initiator der neuzeitlichen Olympischen Spiele, also „Ohri Dünoh“, ihm das verziehen.
Eines Tages fragte mich Walter Keßler, ob ich Lust hätte, etwas für den „Wohnpark - Report“ zu schreiben. Es sollte etwas Heiteres sein, das die Problematik des Zusammenwachsens irgendwie erfassen sollte.
Und so entstanden die folgenden Geschichten in den Jahren ab 1979.
Natürlich habe ich mir lange überlegt, ob meine, durchaus ein wenig bösartigen Geschichten hier ihren Platz haben. Ich meine ja.
Also lauschen wir zunächst einem fiktiven Vortrag aus dem Jahr 3977.
Fast wahre Geschichten (1)
Ein fast wahrer Vortrag aus dem Jahr 3977
Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Ich habe heute die Ehre, als Vertreter der Universität Frechen - Marsdorf zu Ihnen zu sprechen. Mein Thema sind die jüngsten Ausgrabungen in der Köln - Bonner Bucht, die, wie Sie alle wissen, in den letzten Jahren des 20. Jahrhunderts einmal von Menschen bewohnt gewesen sein muss und aus bisher ungeklärten Gründen bis vor einem Jahr unter einer dicken Erdschicht lag.
Es ist uns Archäologen gelungen, große Teile einer Siedlung freizulegen, die einmal den Namen Erftstadt oder ähnlich getragen haben muss. Es wurde eine Tafel gefunden, vermutlich ein Ortsschild, auf dem die Buchstaben L I B L… zu lesen sind. Über die Bedeutung dieser Buchstaben sind wir uns noch nicht im Klaren. Vermutlich ist L I B L … eine verstümmelte, fehlerhafte Form des Namens
L I E B L O S. Die Gelehrten sind sich einig, dass LIEBLOS mit hoher Wahrscheinlichkeit die Stadtplanung und Bauweise bezeichnete. Nehmen wir also an, und weitere Ausgrabungen werden das sicher noch bestätigen, dass der Ortsteil „Erftstadt – Lieblos – hieß.
Unsere Grabungen begannen im höher gelegenen Teil des Ortes. Zunächst stießen wir auf ein Gebäude, auf dem das Wort „Bahnhof“ zu lesen war. Nun gibt es zwar seit gut 1500 Jahren keine Bahnhöfe mehr, aber aus alten Handschriften ist uns bekannt, dass es sich bei einem „Bahnhof“ um eine Haltestelle für Eisenwagen, auch Eisenbahn genannt, gehandelt haben muss.
Doch bei dem von uns ausgegrabenen Bahnhof steht die Forschung vor einem unlösbaren Rätsel: sollte eine sonst recht ordentliche und solide gebaute Stadt wie Erftstadt-Lieblos ein solch altes, unbrauchbares Gebäude wirklich noch 1977 als Bahnhof benutzt haben?
Wir glauben, dass so viel Geschmacklosigkeit nicht einmal in einem solchen Ort herrschte. Daher nehmen wir an, dass das Gebäude als Museum benutzt wurde, zumal die Innenwände deutliche Spuren künstlerischer Tätigkeit zeigen, moderne, etwas gewagte Kunst, wenn Sie wissen, was ich meine, meine Damen und Herren.
Im oberen Teil des Ortes ergaben sich zum Erstaunen aller Archäologen eigenartige Funde. Wir gruben Straßenschilder aus mit der Bezeichnung Heidebr.., Bahnhofs.... und Schlunk... Leider konnten wir auch hier nur unvollständige Namen finden.
Aber das ist nicht so wichtig wie die Entdeckung von Professor Müller aus Oberkassel: Er fand mit seinem Team eine große Anzahl von menschlichen Körpern. Auffällig war daran, dass sie stets trockene Haut hatte. Sie müssen also auf irgendeine Weise verdurstet sein. Vermutlich funktionierte die Wasserversorgung dort oben nicht reibungslos.
Etwas kräftigere Körper fanden wir in der Nähe eines Waldes, vielleicht handelt es sich um einen Park. Die Menschen lebten hier in riesigen, oft flachen Häusern, oft nur zu zweit und offensichtlich auch mit Hunden. Für uns Menschen des vierten Jahrtausends ist das unvorstellbar, aber damals war das wohl so üblich.
Die Menschen in diesen Häusern müssen ungeheure Angst vor Angriffen ihrer Nachbarn gehabt haben, denn fast alle Häuser sind mit Zäunen umgeben. Es kann natürlich auch sein, dass die betreffenden Menschen von hoher Bedeutung gewesen sind. Das wage ich nicht zu entscheiden.
Fast überall in den tiefer gelegenen Ortsteilen förderten unsere Ausgrabungen Gummischläuche zutage, die auf Grünflächen gelegen haben müssen. Ich möchte nicht behaupten, dass hier vielleicht Wasser vergeudet wurde, um die höher gelegenen Ortsteile systematisch zu vernichten. Vielleicht gelingt es den Forschern, irgendwann einmal eine Erklärung dafür zu finden.
Mittler – Weile haben wir auch den südlichen Teil der Stadt ausgegraben. Dabei stießen wir auf fast unüberwindliche Hindernisse: Die einzelnen Häuser liegen so eng beieinander, dass ein ruhiges Ausgraben nicht möglich ist.
Am interessantesten fanden meine Kollegen und ich die frappierende Ähnlichkeit mit der 2035 verschütteten Stadt New York. Vergeblich jedoch suchten wir ein mit der Freiheitsstatue vergleichbares Bauwerk, obwohl anzunehmen ist, dass sich die Erbauer des betreffenden Stadtteils ein Denkmal setzen wollten.
Wir nehmen deshalb außerdem an, dass es sich bei den sehr hohen Gebäuden nicht nur um pure Bosheit handelte, sondern dass hier der selbstlose Einsatz einiger weniger den Turmbau zu Babel wiederholen wollte. In Babel gab es bekanntlich eine Sprachverwirrung. Sollte auch in Erftstadt – Lieblos einer den anderen nicht verstanden haben???
Ich lasse die Frage offen, verweise vielmehr auf das soeben erschienene Buch „Erftstadt - Lieblos im Wandel der Jahrtausende“ und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
P.S. Die Ausgrabungen gehen weiter.
Fast wahre Geschichten. (2)
Betrachtungen aus der Natur: Der Erftstädter (Homo Alogicus).
Es ist schon seltsam, dass die Zoologie sich bis heute um die Beschreibung der Spezies Alogicus, oder auch „Erftstädter“ herumgedrückt hat. Ob dies Bosheit, Desinteresse oder einfach Unkenntnis, will ich hier offen lassen. Fest steht, dass hier schändliches Versagen der Wissenschaft eine Lücke gelassen hat, die geschlossen werden muss.
Welche Bedeutung der Erftstädter im Tierreich hat, lässt sich schwer abschätzen, man darf jedoch annehmen, dass sie an Intelligenz weit über dem Opossum oder dem Erdmännchen liegt. Dies lässt sich schon aus den Behausungsanlagen erkennen. Über die Lebensweise, Gewohnheiten und Knochenbau liegen so wenige Untersuchungen vor, dass intensive Nachforschungen angestellt werden mussten. Ich trage Ihnen hier einige der Ergebnisse vor.
Der Erftstädter gehört zur Familie der Säugetiere. Er ist leicht zu erkennen am meistens aufrechten Gang und an seiner von der Zeit und dem ständigen Kampf zerfurchten Stirn. Er bewohnt die an der Erft gelegenen Auen, zum Teil auch höher gelegene, weite Teile eines alten Braunkohlegebiets.
Wegen seines dicken Fells und seiner Schwerfälligkeit lässt sich eine Verwandtschaft mit dem Ville- Bären nicht leugnen. Manche Exemplare haben sogar eine gewisse Affinität zum Grautier. Ich will aber die Grautiere nicht beleidigen.
Die ersten Exemplare des Homo-Erftstadt-Alogicus müssen schon sehr früh die Felder links und rechts der heutigen Carl-Schurz-Straße bewohnt haben, wie die deutlichen Spuren der Verwüstung zeigen.
Es wird vermutet, dass die Römer sie aus Sicherheitsgründen auf ihrem Weg von Köln nach Trier dort zurückgelassen haben, da sie einer Kultivierung des Rheinlandes im Wege gestanden hätten. Doch die bei aller Schwerfälligkeit erstaunliche Wendigkeit und Schnelligkeit im Höhlenbau brachte sehr bald stattliche Erzeugnisse zu Tage
So bauten sie im Gebiet des heutigen Lechenich, Konradsheim, Blessem, Gymnich, Friesheim und Liblar eigenartige Festungen: die für Säugetiere recht seltenen schlossartigen Gebäude. Sie umgaben sie oft mit Wassergräben, wahrscheinlich zum Schutz oder aber auch nur, um sich von den unterlegeneren Exemplaren des Spezies Alogica abzuheben und ständig die Möglichkeit zu haben, die von Fehden geschlagenen Wunden zu kühlen.
Trotz aller Bemühungen scheint es den Erftstädter nicht gelungen zu sein, ihre schlossartigen Gebäude in ihrer Gewalt zu halten: in Liblar überließ man es kampflos einer anderen Spezies, dem Hormon Economicus oder auch Mana-germanicuss, dessen einziges Ziel es zu sein scheint, dem Ur – Liblarer jeden Zutritt zu verwehren.
In Gymnich gar wurde das schlossartige Gebäude von einer weit aggressiveren Spezies besetzt, dem sogenannten Homo Politicus oder auch Sozio-Democraticus. Es sollen über der Befestigung schon Geier gesehen worden sein, Pleitegeier.
Die praktische Veranlagung des auf den Ville-Auen weidenden Erftstädters zeigte sich darin, dass er aus dunkler Erde kleine, steinartige Produkte presste, mit denen er Feuerstellen über längere Zeit zum Brennen bringen konnte. Vermutlich wegen dieser Fähigkeit gab die Naturkunde ihm auch den schmeichelhaften Namen Ober – Liblarer.
Äußerlich unterscheidet er sich kaum vom Lechenicher oder Unterliblarer, dennoch dürfen einige Fortschritte des Ersteren nicht unerwähnt bleiben. So gelang es dem Homo Alogicus Oberliblariensis, die Eisenbahn von Köln nach Euskirchen nicht durch Lechenich oder Liblar, sondern durch Oberliblar fahren zu lassen.
Noch heute zwingen einige Exemplare kurz nach Sonnenaufgang die Eisenbahn dort zum Anhalten. Die Bahn wird auch von Nichtoberliblarern benutzt, was man als Zeichen für das friedfertige Wesen des Oberliblarers deuten darf …
Nach jahrelanger Isolation ist es endlich gelungen, eine neue Spezies in unmittelbarer Nähe des Homo Liblariensis anzusiedeln. Sie lebt meist isoliert und tritt nie in Rudeln auf. Um einen zu engen Kontakt mit den Uransässigen zu vermeiden, baute man einen „Rüger – Park“, in Anlehnung an ein ähnlich klingendes Reservat in Südafrika auch „Rüger Nationalpark“ genannt.
Tatsächlich gelang es den Liblarern, zunächst jeden Kontakt mit den Neuen unmöglich zu machen und die Neuen ihrerseits trugen dazu bei, nicht mit den Liblarern in Berührung zu kommen. Dieser Zustand wurde recht lange aufrechterhalten, einer wusste von anderen nur, dass er existiert.
Wie Säugetiere nun einmal sind, gab es auch die ersten Konflikte. Um einer kämpferischen Lösung aus dem Weg zu gehen, wurde schnell ein Vermittler gerufen, der heute noch unter dem Namen „Mittler – Immob“ bekannt ist. Dennoch: Es gärt, und die Naturkunde steht vor einem Rätsel: sollte es nicht möglich sein, eine friedliche Lösung der Ortsteile zu erreichen?
Ein weit schwierigeres, in der Geschichte der Entwicklung begründetes Phänomen ist die Ur – Feindschaft zwischen den Exemplaren der Spezies Lechenichiensis und der Spezies Liblariensis.
Vielleicht gelingt es der Evolution, zum ersten Mal in der Geschichte der Erde zwei so verschiedene Spezies unter friedlichen Bedingungen zusammenleben zu lassen. Aber zur Zeit sind wir davon noch weit entfernt.
Der Homo Lechenichiensis feiert bald den 700. Jahrestag des aufrechten Gangs, während der Liblariensis ein stolzes Exemplar in Homo Caroli Schurzi vorweisen kann. Lechenich ist schon im Besitz einer Frei-Suhle während der Liblarer sich dank seines zähen Körperbaus noch in den Seen badet, aber schon erste Schritte zur Errichtung einer Hallen-Suhle unternommen hat.
Trotz allem kann man den Erftstädter oder Homo Alogicus als eine gesonderte, wenn auch sonderbares Spezies begreifen.
Es ist gelungen, Einblick in die Verständigungstechniken der Erftstädter zu nehmen: Wissenschaftler von der Universität Frechen - Marsdorf haben wieder einmal Bahnbrechendes geleistet, indem sie Sprech – und Gestikulationsweisen des Erftstädters registriert und untersucht haben. Hier sind einige der wichtigsten Ergebnisse:
Wir müssen deutliche Unterschiede machen zwischen dem Homo Kierdorfiensis und dem Lechenichiensis, dann wieder zwischen dem lippla Liblariensis und dem Bliesheimus.
Am Rand, weil völlig systemfrei, steht der Erpicus, der sich eine Mischung aus Keltisch und Kisuaheli mit Elementen aus dem Niederrheinischen bewahrt hat und es dem Verhaltensforscher außerordentlich schwer macht, mit seinen Tonaufnahmen etwas anzufangen.
Der Erpicus zeichnet sich durch die mehrsilbige Aussprache an sich einsilbiger Wörter aus: Seine Heimat Erp würde er nie anders als „Äräp“ aussprechen, mit leichter Betonung des mittleren „r“. Besonders hübsch muss man sich die Aussprache der Verladestation für Zuckerrüben vorstellen: dort heißt die „Erper Rübenrampe“ oder „ÄräpeRööverramp“. Vielleicht ist die Sprache der Grund dafür, dass sich zum nächst gelegenen Dorf keine direkte Verbindung in Form einer Straße finden lässt: nach Ahrem (in Erpisch: „die doh hinge“) kommt man nur auf Umwegen.
Nun zu den anderen Lautarianten.
Betrachten wir den Kierdorfiensis. Er zeichnet sich durch eine Laune der Natur aus: er hat zwei Backenzähne mehr als der Erpicus, spricht daher völlig anders als der Bliesheimus. Während der Bliesheimus, Homo Rohmedräjer) und der Lechenichensis (Homo Windbüggelensis)) das Fest des Schützenvereins „Schötzefess“ aussprechen, bringt es der Keirdorfiensis auf ein stolzes „Schötzefäls“ mit deutlicher Hervorhebung des an sich nicht vorhandenen „l“ wie im Wort für „essen“: „ählze“.
Der Blessemicus (Homo Agriculturiensis) ist charakterisiert durch die fantastische, nicht voraussagbare Aussprache der Vokale a,e,i,o,u und so heißt „Mist“ auf Blessemisch „Möess“, die „Misteln“ heißen „Möesspelle“.
Ich könnte die Reihe noch beliebig fortsetzen, will aber trotz des interessanten Phänomens hier nur auf einen Vortrag von Professor Hubert Benderbacher hinweisen, der über die Bedeutung einiger Worte des Erftstädtischen geschrieben hat.
Sein letztes Buch heißt: „Was ist häufiger: af un ahn, manneschmool, lutte oder döckes?“
Man kann, soweit ich sehe, feststellen, dass „lutte“ etwa doppelt so oft es wie „döckes“, während „af un ahn“ fast ebenso häufig ist wie „manneschmool“.
Um den Erftstädter zu verstehen, müssen noch viele Jahre intensiver Forschung betrieben werden. Doch diese Zeilen mögen dazu dienen, ein großes Vorurteil auszuräumen. Der Erftstädter ist rau, aber herzlich, im Ganzen gesehen liebenswert und erhaltenswert, ein interessantes Phänomen und gleichzeitig eine Bereicherung für die Naturkunde.
Fast wahre Geschichten (3).
Es brennt.
Eingeweihte wissen, welche Orte im Folgenden gemeint sind. Ja, richtig: es ist Ober … – aber so einfach wollen wir es nicht machen. Jeder sollte sich selbst die Mühe machen herauszufinden, wo sich die beiden Orte befinden. Aber Vorsicht es könnte ja auch ihr Ort sein …
Nun wäre ja eine Feindschaft an sich noch nichts Besonderes, wissen wir doch alle, wie schwach wir Menschen sind. Doch Oberdorf und Unterdorf sind in eigentümlicher Weise durch ihre Feindseligkeiten verbunden.
Es ist eine Hassliebe, die erst aufgehört hat, als man einen neuen, gemeinsamen Gegner fand, das Neubaugebiet. Wir Oberdorfer haben als Braunkohledorf angefangen, die Unterdorfer einige Jahrhunderte vor uns. Die Römer, die von Köln über Lechenich und Zülpich nach Trier und weiter gezogen waren, haben das Unterdorf überhaupt noch nicht gekannt, weil man sich erst hinter Lechenich die ersten Blasen gelaufen hatte und zu einer Rast gezwungen war. Erst mit den Grafen Metternich, die ins Unterdorf ein Schloss bauten, konnte der Stolz der Unterdorfer sich entfalten.
In der alten Auseinandersetzung mit uns Oberdorfern muss man dem Unterdorfern eins zubilligen: Sie haben Heimrecht, und jede Kampfhandlung ist für sie ein Heimspiel. Wir Oberdorfer stehen zwar unter dem Schutz der Heiligen Barbara und des Heiligen Donatus, doch mengenmäßig sind uns die Unterdorfer überlegen. Das gleichen wir wieder aus: wir haben einen Bahnhof - Sie haben Carl-Schurz, wir einen Fußballverein.
Eine Episode sollte stellvertretend für viele erwähnt werden:
Es war an einem heißen Junitag in den fünfziger Jahren. Ein sehr heißer Tag, die Quecksilbersäule wurde ganz lang und blau, 38 °C, und das Feuer hätte sich auch bei größter Vorsicht nicht vermeiden lassen. Ja, es brannte lichterloh. Ein altes Haus drohte den Flammen zum Opfer zu fallen. Die Sirene ertönte. Im Oberdorf. Nur da? Nein, auch im Unterdorf.
Man wird sich fragen, warum in beiden Gemeinden gewarnt wurde. Ein unglücklicher Umstand hatte es so gewollt, dass der Brandherd sich auf der Grenze zwischen beiden Dorfteilen befand.
Und so eilte man hüben und drüben zu seinem Feuerwehrhaus. Die Feuerwehr des Oberdorfes raste bergab, die des Unterdorfs ein Stück bergauf.
Das Unvermeidliche traf ein. Beide Wehren trafen an der Brandstelle ein. Der Brandmeister aus Oberdorf setzte seinen Kampfhelm auf, rückte sein Koppel zurecht und schritt finsteren Blicks auf die Unterdorfer Wehr zu. Der Brandmeister der Unterdorfer griff zur Vorsicht hinter sich und riss eine Sturmaxt aus der Halterung, die er demonstrativ schulterte, bevor er sich auf den Weg zur Verhandlung mit seinem Rivalen machte.
Nun standen sie sich gegenüber. Kräftige, ehrbare Feuerwehrleute, die ihre Aufgabe stets darin gesehen hatten, Brände zu löschen und Menschen zu schützen. Sie standen da: Aug in Aug, Unterdorf gegen Oberdorf. Wer würde nachgeben?
Der Chef der Unterdorfer Feuerwehr richtete noch einmal seine Uniform, dann dröhnte er seinem Todfeind entgegen: „Haut ab, dat is unser Feuer!“
Nun der Oberdorfer Feuerwehrchef: „Quatsch. Siehst du dann nit, dat die Flamme und der Quallem no owwe trecke? Dat is unser Feuer!“
So ging es eine Weile, Behauptung stand gegen Behauptung, keiner gab nach. Das wäre als Schwäche ausgelegt worden. Nun wurde in der Vergangenheit gewühlt: „Wenn mir damals net jewese wöre, als ür Amtsjebäude gebrannt hät, dann hättet ür jetz ene freie Platz mie in ürem fiesen Ungerdörep!“ sagte der Oberdorfer Feuerwehrchef.
„Und wat es mit ürem Fabrikbrand? Wenn mir nit jewese wöre, hätt ür die janze Winter ohne Klütte doh jesesse, ihr Knallköpp! Macht dat ür heem kott, dat es und bliev oser Füer!“, war die ebenso klare wie kränkende Antwort des Unterdorfers.
Keiner der Feuerwehrleute bemerkte, dass es Nachbarn und einigen Passanten mittlerweile gelungen war, mit Wassereimern dem Brand ein Ende zu setzen.
Dem Kassenwart der Kameradschaftskasse von Unterdorf nur ist es zu verdanken dass man sich einigte, ohne die Sturmäxte zu Hilfe zu nehmen. Er trat mutig zwischen die beiden und machte einen grandiosen Vorschlag, der sonst niemandem in den Sinn gekommen wäre: „Löscht doch zusammen!“
Von so viel Klugheit überwältigt begaben sich beide Feuerwehrchefs zu ihren Leuten und erteilten die notwendigen Kommandos. In Windeseile ergoss sich über das längst nicht mehr brennende Haus ein Wasser, das der Regenmenge von acht Jahrzehnten entsprach. Aber es ging ja ums Prinzip.
Jede der beiden Feuerwehren versuchte, die andere in der Wasserleistung zu überbieten. Man achtete beiderseits mehr auf den andern als auf das Haus, das mittlerweile im Besitz eines Kellerschwimmbades war und spritzte, was die Schläuche hergaben.
Leitungen wurden gelegt, der Wassergraben um das Schloss war dank des Einsatzes der Unterdorfer Wehr um einen Kilometer verlagert worden. Karpfen schnappten noch eine Weile nach Luft, gaben aber bald auf.
Die Oberdorfer hatte mithilfe eines ausgeklügelten Rohrsystems einen Waldsee in eine Moorlandschaft verwandelt. Der ganze Segen ergoss sich über das alte Haus. Die Fundamente gaben ihr Bestes, konnten aber den selbstlosen Feuerwehrleuten nicht mehr lange Widerstand leisten.
Es störte auch niemanden, als der Giebel des alten Hauses, der noch einige Minuten aus dem neu entstandenen Teich herausgeschaut hatte, endlich untertauchte. Das Feuer war jedenfalls aus, und zwar mithilfe beider Feuerwehren.
Nun gut, man hatte mit den Wassergüssen die Landschaft ein wenig verändert, und es dauerte Jahre bis jener Ort auf der Grenze zwischen Oberdorf und Unterdorf wieder mit etwas anderem bepflanzt werden konnte als mit Reis.
Zum Dank für die gelungene Aktion stiftete die Amtsverwaltung ein Holzkreuz, das heute noch am Tatort zu sehen ist. Es heißt das „Spürkerkreuz“.
Und so gingen die Jahre dahin, aus den verfeindeten Brüdern sind jetzt Gegner geworden, die sich gegenseitig wieder aufhelfen, um wieder einen Gegner zu haben. Und… man hatte ja die Neuen, aus dem komoschen Neubaugebiet…
Anhänge:
Letzte Änderung: 4 Jahre 11 Monate her von Bernd Offizier.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bernd Offizier, Walter Gollhardt
Bitte Anmelden um der Konversation beizutreten.
Ladezeit der Seite: 0.581 Sekunden